Welche Trends zeichnen sich im globalen Handel ab und wie reagieren Händlerinnen und Händler darauf? Antworten gaben Vordenker*innen aus Forschung, Wirtschaft und Praxis an der 75. Internationalen Handelstagung, die wir für Sie zusammengefasst haben.
Im Handel ist die Kundennähe von zentraler Bedeutung, wie Johannes C. Bauer, Head of Think Tank beim GDI, aufzeigte. Der stationäre Konsum verschiebt sich zunehmend in die Agglomerationen und in die Nähe zum Wohnort. Damit fordern veränderte Frequenzmuster und Einkaufsmotive die Unternehmen heraus, ihre Standortstrategie und das Angebot zu überdenken.
Ein Paradebeispiel für lokale Kundennähe ist Valora. Fast die gesamte Schweizer Bevölkerung findet innerhalb von 10 Kilometern eine Filiale, die zu der Gruppe gehört. Dabei punktet CEO Michael Mueller in den Geschäften mit ausgewählten Dienstleistungen und Produkten, allen voran mit Foodvenicene – frisches Essen für unterwegs. Veränderte Frequenzmuster fordern aber auch seine Betriebe: Noch vor einigen Jahren wurden die Valora-Filialen in den frühen Morgenstunden für Kaffee und Gipfeli rege besucht. Die Nachfrage ist zwar weiterhin hoch, doch hat sich die Pendlerzeit massiv verlängert. Der Anspruch bleibt der gleiche, wie Michel Mueller erklärt: «Die Kund*innen, die erst um 10 Uhr ins Büro gehen, erwarten auch dann noch ein frisch aufgebackenes Gipfeli.»

Auch die digitale Welt verändert sich: E-Commerce-Plattformen und künftig auch KI-Agenten buhlen um die Kundschaft. Die interaktive Fragelogik verlangt nach neuen Konzepten, damit die eigenen Produkte auch via ChatGPT und Co gefunden und gekauft werden. Nur so bleiben Händler auch digital nah an den Kund*innen. Auf emotionaler Ebene zählt längst nicht mehr nur Zufriedenheit. Mitarbeiter und Kundinnen möchten ihre Werte bei Marken und Unternehmen wiederfinden. Händler, welche die emotionale Verbundenheit als KPI definieren, profitieren.
Das Ende der flachen Welt
Die aktuelle ökonomische und geopolitische Lage hat sich in jüngster Zeit drastisch verändert und stellt auch den Einzelhandel vor grosse Herausforderungen, wie Wirtschaftsprofessorin Beatrice Weder di Mauro erklärt: «Wir stehen vor einer Zäsur der flachen Welt: Die Ära einer zunehmend nahtlosen, grenzenlosen globalen Welt, in der Kapital, Güter und Wertschöpfungsketten dort positioniert wurden, wo sie am produktivsten und effizientesten waren, geht zu Ende.» Mit der Rückkehr von Grenzen ist der Standort und dort vorherrschende Institutionen für Unternehmen wieder wichtiger als nur der Markt. In der Zukunft zeichnet sich laut Beatrice Weder di Mauro eine multipolare Welt ab, die vermutlich von diversen Allianzen und tiefen Sicherheitsgarantien geprägt sein wird. Unternehmen tun darum gut daran, stabile Beziehungen aufzubauen sowie Konsolidierungen in Betracht zu ziehen, um Fragmentierungen zu überwinden.

Neue geopolitische Bedingungen stellen Händler vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig drängen neue Konkurrenten in den Markt. Ein Blick nach China zeigt, worauf sich der Retail einstellen muss und wo sich neue Chancen bieten.
Mehr als nur «Made in China»
Die Umsätze von Konsumgütern in China steigen an. Unterstützt wird dies von der chinesischen Regierung, welche China vom klassischen Produktionsland hin zu einem «Consumption Powerhouse» transformieren will, das den globalen Nachfragemarkt antreibt. Gemäss Markus Herrmann Chen von der China Macro Group steckt der chinesische Einzelhandel noch in den Kinderschuhen mit gleichzeitig hohem Wachstumspotenzial. Das könnte für europäische Unternehmen eine Chance sein, in den Markt einzusteigen, beispielsweise über lokale Plattformen wie TMall oder AliExpress. Neben dem einheimischen Markt wächst auch der Export nach Europa. Was in China produziert wird, soll vermehrt auch direkt über chinesische Marken verkauft werden. Herrmann rät Retailern, sich auf diese Konkurrenz vorzubereiten: «Studieren Sie die Strategien dieser Unternehmen, messen Sie sich mit ihnen und prüfen kreative Synergien sowie Kollaborationen.»
Wie dynamisch chinesische Trends auf den europäischen Markt überschwappen, zeigt die boomende «Emotional Economy». Diese beinhaltet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Fitness, Gastronomie, Unterhaltung und «Goods», wie etwa die derzeit beliebten Labubu-Stofftiere des chinesischen Herstellers Pop Mart.
Emotionen statt Transaktionen
Retail hat sich verändert. Emotionen werden wichtiger und es geht längst nicht mehr nur um die Transaktion von Wert gegen Geld. Chris Sanderson, Mitgründer vom The Future Laboratory sieht die Zukunft in den drei T: Wahrheit (truth), Transparenz und Vertrauen (trust). Sie bilden die Basis für den Aufbau erfolgreicher Beziehungen mit den Kund*innen. Die von Johannes Bauer erwähnte emotionale Nähe steht auch bei Chris Sanderson im Zentrum, denn Handel habe nichts mit Logik zu tun: «Unsere menschlichen Wünsche und emotionalen Bedürfnisse nach Bestrebungen, Komfort und Sicherheit treiben den Handel an. Wir wollen Produkte, die uns begeistern, uns Träumen lassen und uns ein besseres Gefühl über uns selbst geben.» Das gelingt beispielsweise durch mitgliedbasierte, exklusive Erlebnisse, welche die Bildung von Communities begünstigen. Marken kommunizieren dabei nicht zu, sondern mit den Kunden im Kollaborations-Prinzip. Ein weiterer Hebel sind Bonusprogramme. In der neuen Retail-Realität sollte Partizipation statt nur Käufe belohnt werden. Idealerweise mit einem Gamification-Ansatz und direktem Vergleich mit anderen Kund*innen, was wiederum die Community und die drei T stärkt. Statt undurchsichtiger Loyalität liefern Marken damit versprochene Erlebnisse durch sichtbares und messbares Engagement.
Die langfristig nachhaltige Zukunft liegt also im Aufbau von echten Beziehungen mit den Kund*innen. Durch gemeinsame Werte, Erlebnisse und Relevanz. Das gilt selbst dann, wenn der Kundenlebenszyklus sehr kurz ist.

Kompetent nah dran: vor Ort und digital
Die Kundinnen von Anna Weber, Co-CEO von Babyone, sind nach vier Jahren bereits nicht mehr in ihrer Hauptzielgruppe. Denn der Fachmarkt setzt auf Produkte für Babys und Kleinkinder bis vier Jahren. Dennoch schafft es Babyone, in den entscheidenden Momenten ganz nah an den Kundinnen zu sein und eine Beziehung mit ihnen aufzubauen. Mit einem Franchise-System ist Babyone an 104 Standorten mit individueller Beratung sowie Testmöglichkeiten vor Ort relevant und sichert sich mit dem Onlineshop eine digital nahtlose Anbindung. Die emotionale Nähe decken Anna Weber und ihr Team durch eine gezielt personalisierte Ansprache ab, indem sie die werdenden Mütter mit edukativem Inhalt gezielt auf ihrer Reise begleiten. Damit hat das traditionelle Familienunternehmen den Sprung zur digitalen Nähe und Relevanz geschafft.
Für den Aufbau von starken Beziehungen ist Vertrauen essenziell. Vertrauen der Kund*innen in die Marke sowie in die Produkte und Dienstleistungen. Dasselbe gilt auch intern.
Vertrauen als Basis für Performance

Leistungsstarke Teams investieren in gute Beziehungen, um gemeinsam weiterzukommen und sprechen inhaltliche Konflikte an, um noch bessere Lösungen auszuarbeiten. Für Wolfgang Jenewein, Titular Professor of Leadership an der Universität St. Gallen bildet Vertrauen die Basis für eine hohe Leistung. Denn nur wenn psychologische Sicherheit gegeben ist, werden Konflikte angesprochen. Durch den konstruktiven Diskurs leisten alle im Team einen Beitrag, setzen sich gemeinsam für die Lösung ein und übernehmen für die eigene Rolle Verantwortung. Oft würden sich Vorgesetzte maskieren, keine Schwächen zeigen und nur auf Stärken setzen. Doch Wolfgang Jenewein ist überzeugt, dass gerade Verletzlichkeit zu echtem Vertrauen führen kann.
Vom Zielkonflikt zur Innovation
Der Beweis, wie erfolgreich eine Vertrauenskultur sein kann, liefert Antje von Dewitz, CEO von Vaude. Seit 15 Jahren setzt die Outdoormarke Nachhaltigkeit konsequent und systematisch in den Fokus. Oder in Zahlen: -40 % Emissionen bei 27 % Umsatzwachstum seit 2019. In der Textilindustrie begegnete sie dabei grossen Zielkonflikten – von der fehlenden Kundennachfrage bis hin zu Produzenten, die ihre Materialien nicht anpassen wollten. Als die Unternehmerin das Geschäft von ihrem Vater übernahm, war ihr schnell klar, dass sie Menschen braucht, die Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit ihr für die Lösungen kämpfen. Darum investiert sie in die Unternehmenskultur mit aktiver Beziehungspflege, Schulungen in der Selbstwirksamkeit und vielen weiteren Massnahmen, die sie gemeinsam mit den Mitarbeitenden erarbeitete. Die Vertrauenskultur ist für Antje von Dewitz die Basis für den Erfolg: «Das schafft eine hohe Motivation am Arbeitsplatz, die Fähigkeit, komplexe Themen anzugehen und die Sicherheit, dass wir aus Zielkonflikten Innovationen schaffen können.»
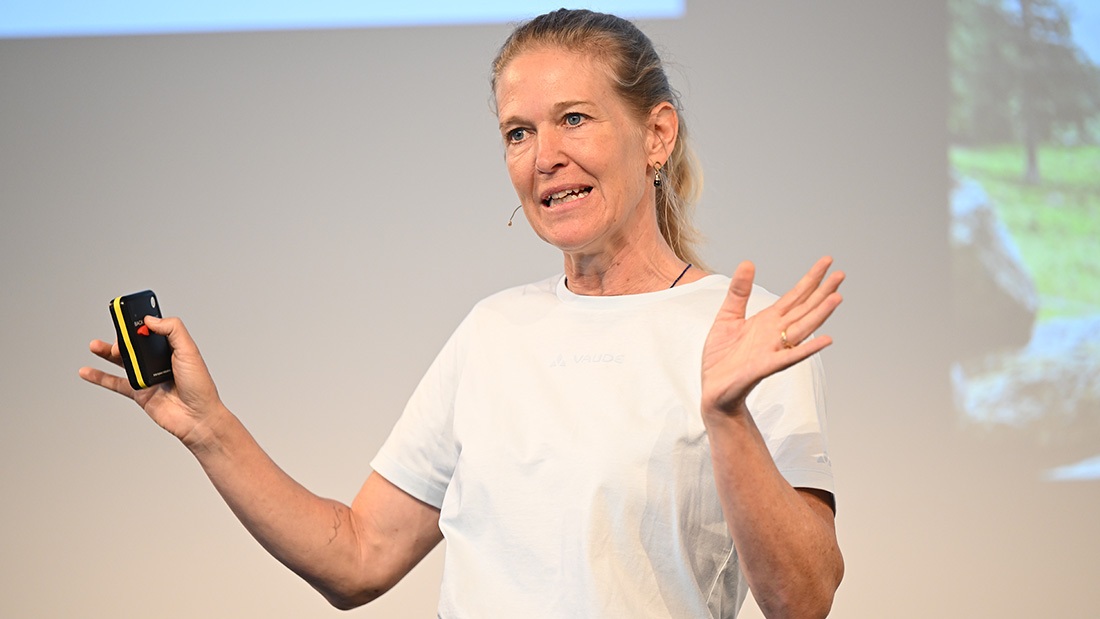
Wie KI die Zusammenarbeit fördert
Wie Menschen miteinander interagieren wird auch von ihrem Umfeld bestimmt. Denn der Mensch ist eingebettet in einem komplexen, sozialen Netzwerk. Yale-Professor Nicholas Christakis untersucht, wie sich Interaktionen innerhalb von Netzwerken abspielen und die Gruppe als Ganzes beeinflussen. Insbesondere, wenn KI-Agenten mit von der Partie sind. Denn gemäss seinen Experimenten kann KI Menschen bei der Lösung von kollektiven Herausforderungen wie Koordination, Kooperation und Kreativität unterstützen. Dabei verwenden er und sein Team keine komplexen KI-Modelle wie ChatGPT & Co: «Wir können es uns leisten, dass unser KI-Agent dumm ist, weil Menschen intelligent sind. Es reicht, wenn wir den Menschen die Zusammenarbeit erleichtern. Unser Ziel ist nicht die menschliche Kognition zu ersetzen, sondern lediglich deren Interaktion zu ergänzen.»

Die Internationale Handelstagung fand vom 10. bis 11. September 2025 im Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon bereits zum 75. Mal statt. Die Tagung bot den Teilnehmer*innen in ungezwungener Atmosphäre zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken und überraschte mit einem kreativen kulinarischen Angebot.
Save the Date und Ausblick
Die nächste Internationale Handelstagung findet am 16. und 17. September 2026 in Rüschlikon statt. Sichern Sie sich bereits jetzt das Datum und erfahren Sie die neusten Trends des Handels. Sie suchen zwischenzeitlich noch mehr Inspiration? Entdecken Sie die nächsten Konferenzen und vernetzen sich mit Branchenexperten und Pionierinnen in einer der schönsten Eventlocations am Zürichsee.








