Innovation durch Künstliche Intelligenz? Gemäss Carl Benedikt Frey, Professor für Künstliche Intelligenz und Arbeit an der Oxford University, reicht der Einsatz von bestehender Technologie nicht aus, um langfristig erfolgreich zu sein. Denn Wachstum beruht auf Erfindungen, aus denen neue Industrien und Arbeitsplätze entstehen. KI bezieht sich auf bestehende Datenpunkte, was kaum echte Innovationen hervorbringe. «Könnten wir in der Zeit zurückreisen, hätte KI nicht das Fliegen erfunden», so Carl Benedikt Frey. Es reiche also nicht, das Bestehende zu automatisieren, sondern man müsse stets das Neue suchen. Gleichzeitig sprengt KI laufend die Grenze, die wir bis anhin für möglich gehalten hätten. Daniel Susskind, Professor für Wirtschaftswissenschaften am King’s College London, rechnet damit, dass diese Entwicklung anhält. Es ist also weniger eine Frage, ob sich unsere Arbeitsrealität verändert, sondern wann diese eintreffen wird.
Zukunftsfähiges Wissen
Adaption und Flexibilität sind daher in den Augen von Daniel Susskind entscheidende Fähigkeiten. Bei dem schnellen Wandel der KI-Technologie ist es schwierig, abzuschätzen, welche Skills in Zukunft noch nützlich sind. So brachte man vor ein paar Jahren jungen Menschen das Codieren bei, um sie für die Zukunft zu rüsten. Eine Aufgabe, die KI bereits heute im grossen Umfang übernimmt. KI baut zudem Einstiegshürden ab, wovon Anfänger im Vergleich zu Expertinnen stärker profitieren. Ein Beispiel dafür ist Uber: Während das detaillierte Wissen über jede Strasse von erfahrenen Taxifahrern plötzlich an Wert einbüsste, arbeiteten neue Uber-Fahrer ohne langjährige Erfahrung direkt mit GPS erfolgreich. Die moderne ICT führte in den letzten Jahren zu einem Rückgang der globalen Ungleichheit. Carl Benedikt Frey wirft die Frage in den Raum, ob KI diese Tendenz umkehren oder verstärken wird.

Maschinen sind dem Menschen beim Abrufen von explizitem Fachwissen bereits heute überlegen. Wie behaupten wir uns in dieser neuen Arbeitsrealität? Bildung bleibt laut Manu Kapur, Professor für Learning Sciences and Higher Education bei der ETH, weiterhin entscheidend. Dabei beinhaltet Fachexpertise neben dem expliziten auch implizites Wissen, wie etwa kritisches Denken oder das berüchtigte Bauchgefühl. Beides ist in einem adaptiven Prozess verknüpft. Während beispielsweise das Kopfrechnen mit der Erfindung des Taschenrechners an Bedeutung verloren hat, bedingt kritisches Denken ein fachliches Grundverständnis. Eine Mischung aus Wissensvermittlung und explorativem Lernen fördert gemäss Manu Kapur konzeptionelles Denken und unsere Fähigkeit uns anzupassen.
Wenn Maschinen die Arbeit übernehmen
Angesichts der tiefen Gewinnmargen in vielen Branchen und einer Verschiebung der Arbeit in andere Länder zeigt Frey auf, dass es neue Möglichkeiten des Arbeitens braucht, um das Wachstum weiter aufrechtzuerhalten. Susskind geht davon aus, dass Arbeitslosigkeit ein realistisches Zukunftsszenario ist. Führen Maschinen unsere Arbeit aus, führt er drei mögliche Herausforderungen auf. Einerseits sei es eine Frage der Verteilung: Wie teilen wir den Wohlstand untereinander auf, wenn der Arbeitsmarkt nicht für alle eine Beschäftigung anbieten kann? Ein zweites Problem sieht er in der politischen Macht von Unternehmen, die wenig reguliert seien. Als dritten Punkt nennt er die Sinnstiftung, die ohne Arbeit wegfallen könnte.

KI regiert die Welt – und jetzt?
Für Daniel Susskind ist in einer KI-geprägten Zukunft der Staat als regulierendes Gremium entscheidend. Etwas anders sieht das Douglas Rushkoff, Professor für Medientheorie und digitale Ökonomie an der City University of New York. Er sieht die Lösung eher in einer Rückbesinnung auf unser soziales Miteinander. In einer starken lokalen Community nehme die Abhängigkeit von Unternehmen und deren Macht über das Individuum ab. Statt Hilfe beim Staat zu suchen, sollten wir uns wieder stärker unseren Gegenübern zuwenden. In einer Welt, in der KI vorherrscht, sei das Menschsein umso wichtiger. Etwa Werte wie Empathie und Hilfsbereitschaft, die über die Kompetenz von Maschinen hinausgehen. Denn «Zeit ist nicht das Ticken der Uhr, Zeit ist der Raum zwischen den ‘Ticks’», so Douglas Rushkoff.
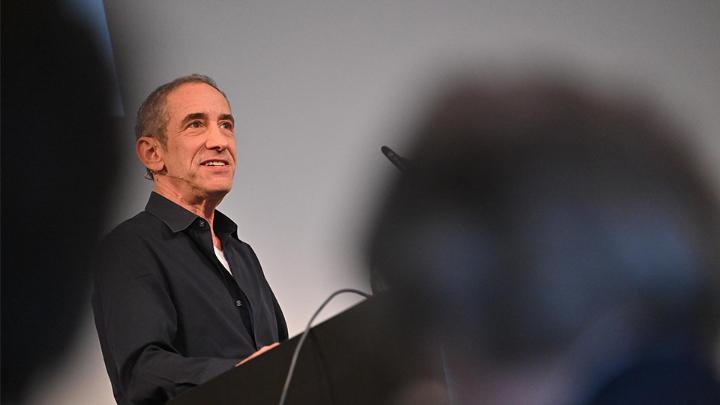
Auch Nora Bateson, Gründerin und Präsidentin des International Bateson Institute, plädiert dafür, die Wahrnehmung über den Algorithmus hinaus zu erweitern. Auch wenn KI Teil unserer Realität ist, untersucht sie mit der Warm-Data-Theorie den Raum zwischen 0 und 1. Denn die Welt bestehe nicht aus isolierten Datenpunkten, sondern sei ein Netzwerk von Beziehungen. Um grosse Krisen gemeinsam zu bewältigen, schätzt Maya Ben Dror, Mitgründerin und COO von ComplexChaos, KI-Technologien als Potential ein. Denn in einer sich wandelnden Welt müssen wir Silos aufbrechen und durch smarte Systeme eine Kultur des Vertrauens und der Kooperation schaffen.
Alles Neu
Der Einsatz von KI führt in unterschiedlichen Branchen zu neuen Herausforderungen. Bilder, Stimmen und Texte werden beispielsweise zum Training von KI-Modellen ohne Einverständnis der Artist*innen als Datenbasis genutzt. Holly Herndon, Komponistin, Musikerin und Klangkünstlerin, zeigt, dass das Abholen einer ausdrücklichen Zustimmung («Opt-In-Verfahren») kaum realistisch ist. Sie hat darum eine sogenannte «Opt-Out»-Lösung entwickelt, bei der die Möglichkeit besteht, eigene Inhalte von der Datenbasis auszuschliessen. Ausserdem verschieben sich durch neue KI-Tools die Marken- und Inhaltshoheit von Firmen. Max Lederer, Chief Innovation Officer bei Jung von Matt Deutschland, zeigt, wie in den letzten Jahren Fans vermehrt eigenständig Inhalte zu Marken generieren. Das zwingt Firmen zum Handeln, birgt aber auch ein grosses Potential für Interaktionen.
Raum für Kreativität

Neben der kritischen Auseinandersetzung mit dem Urheberrecht beschäftigte sich Holly Herndon bereits seit einigen Jahren mit der Verschmelzung von KI und Kunst. Für sie bietet die Technologie neue Möglichkeiten für gemeinschaftliches Schaffen, die Interaktion mit ihrer Fangemeinschaft sowie für komplett neue Kunstformen, bei denen die Technologie als Medium genutzt wird. Indem die KI repetitive Tätigkeiten übernimmt, sieht Jakub Samochowiec, Senior Researcher am Gottlieb Duttweiler Institut, in der Technologie ebenfalls den Mehrwert, dass sie Raum für Kreativität schafft. Ähnlich wie die Erfindung des Fotoapparates nicht zum Aussterben der Kunst führte, sondern diese sich vom Realismus hin zum Expressionismus entwickelte. Trotzdem regt er an, nicht nur aus Bequemlichkeit auf maschinelle Tools zurückzugreifen. Das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten bleibt entscheidend, damit wir auch künftig relevant bleiben. Insbesondere bei Entscheidungsprozessen ist das zentral. Ansonsten laufen wir Gefahr, an Originalität, Varianz und kritischem Denken einzubüssen.
Ausblick
Wir freuen uns darauf, Sie am 25. März 2026 zum 22. Europäischen Trendtag bei uns zu begrüssen.
Für mehr Inspirationen melden Sie sich jetzt für die 5. International Food Innovation Conference am 19. Juni 2025 an oder besuchen uns an der 75. Internationalen Handelstagung am 10. und 11. September 2025 im Gottlieb Duttweiler Institut.